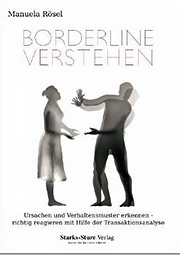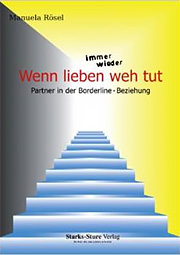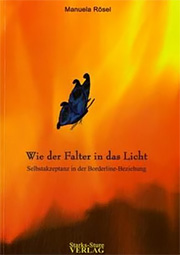|
|
| "Borderline verstehen" |
| Eine transaktionsanalytische Betrachtung der Borderline-Persönlichkeitsstörung
|
"Borderline verstehen" vermittelt im ersten Teil des Buches zunächst Grundlagenwissen zur Transaktionsanalyse. Ein leicht verständliches Konzept, welches sowohl auf der Ebene der Kommunikation, als auch im Bereich der Verhaltensanalyse viele hilfreiche Impulse des Verstehens und der Einflussnahme ermöglicht. Im zweiten Teil des Buches setze ich mich dann direkt mit einigen scheinbar unerklärlichen Verhaltensmustern der Störung auseinander, welche, transaktionsanalytisch betrachtet, so einen eher logischen und nachvollziehbaren Hintergrund erhalten. Neben den Ursachen, die zur Entstehung der Störung führen, gehe ich auch auf typische Fehlannahmen und Vorurteile ein. In diesem Zusammenhang setze mich u. a. auch mit der bisher noch leider zu wenig beachteten Veranlagung zur Hochsensibilität auseinander, die m. E. n. eine der genetischen Voraussetzungen darstellt. Ein ebenfalls interessanter Bereich, der durch die Transaktionsanalyse fassbarer wird, ist die destruktiv geprägte Kommunikation Betroffener sowie die zum Spaltungsmechanismus gehörenden Externalisierungen (Inszenierungen). Dabei wird äußere Realität dem inneren Erleben angepasst, was letztendlich zu den immer wiederkehrenden oft hochdramatischen und konsequenzreichen Konflikten führt. In welchen Abläufen dies geschieht (Spiele) und wie man mit derartigen Inszenierungen besser umgehen kann, nimmt einen weiteren Teil des Buches ein.
Der Verlag zum Buch:
Der neue Ratgeber von Manuela Rösel, der Autorin des Bestsellers Wenn lieben weh tut, bietet ein leichtes Verstehen von hoch komplizierten Verhaltensweisen, für die es bisher keine oder nur unzureichende Erklärungen gab. Das Buch enthält eine gut strukturierte Einführung in die Transaktionsanalyse und ermöglicht dem Leser, mit diesem Wissen nahtlos in die unterschiedlichsten Facetten der Borderline-Störung einzutauchen. Dabei werden - belegt durch zahlreiche Beispiele - sowohl die Ursachen dieser Persönlichkeitsstörung aufgezeigt als auch typische symptomatische Verhaltensmuster Betroffener dargestellt. Angehörige und Partner von Borderline-Persönlichkeiten erhalten nicht nur neue Orientierungs- und Differenzierungsmöglichkeiten, sondern auch wertvolle Hilfestellungen, die es ihnen ermöglichen, wesentlichen Einfluss auf ihr eigenes Leid und das der Betroffenen zu nehmen - und somit das eigene Ich zu stärken und zu stabilisieren. Auch für Therapeuten ist dieses Buch von Manuela Rösel, das aus dem reichen Schatz ihrer langjährigen praktischen Erfahrungen im Umgang mit Betroffenen schöpft, ein wertvoller und unentbehrlicher Ratgeber. Verstehen ist der erste Schritt auf dem Weg des Miteinanders.
|
 Leseprobe |
Leseprobe |
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
 LeseprobeBorderline verstehen ...
Eine transaktionsanalytische Betrachtung
©Manuela Rösel
Frustrationsintoleranz, Wechselhaftigkeit und Ziele
LeseprobeBorderline verstehen ...
Eine transaktionsanalytische Betrachtung
©Manuela Rösel
Frustrationsintoleranz, Wechselhaftigkeit und Ziele
Menschen, die im Abspaltungsmechanismus verharren, neigen zur
Frustrationsintoleranz. Ihre
Bedürfnisse haben in ihrem Erleben existenziellen Charakter. Deren Befriedigung
bedeutet für
sie Leben, Nichtbefriedigung heißt sterben. Wie auch in der realen Zeit der
Abspaltung existiert
hierzu kein begriffliches Denken, sondern ein rein emotionales Wahrnehmen, das
direkt, mit
den einst erworbenen Eltern-Ich Informationen verbunden ist. Ein einfacher
Mechanismus, der
das Überleben eines abspaltenden Kindes absichert und zumindest in der realen
Zeit eines
Kleinstkindes, nichts mit Tyrannei zu tun hat.
Die bedürftige kindliche Borderline-Persönlichkeitsstruktur agiert immer im
Moment des
aktuellen Bedürfnisses, auf das sich Betroffene dann meist fixieren. Das
ausgeprägt freie Kind-
Ich handelt rein lustorientiert. In dem Augenblick, in dem ein Bedürfnis präsent
ist, muss es
auch erfüllt werden. Ähnlich wie bei den Rollen definiert sich eine
Borderline-Persönlichkeit
häufig über die Befriedigung ihrer Bedürfnisse oder das Erreichen eines Ziels.
„Wenn ich diesen
Mantel habe, werde ich gut aussehen. Alle werden mich bewundern, ich werde mich
dann
sicher und attraktiv fühlen. Wenn ich diesen Job habe, werde ich Geld verdienen
und geachtet
werden. Wenn ich ... Kind, Mann, Job, Wohnung-dann wird alles gut“. Die
Abspaltung bleibt
präsent, bekomme ich es wird alles gut (weiß), bekomme ich es nicht, ist alles
vorbei
(schwarz). Unschwer zu erkennen ist auch hier die Fixierung auf das
überlebenswichtig
ersehnte o.k. Jede Bedürfnisbefriedigung stillt zumindest im Augenblick den
unstillbaren
Hunger nach dem o.k.
Hier findet sich auch die Ursache, für die Unfähigkeit vieler
Borderline-Persönlichkeiten mit
Geld umzugehen. Der Manipulation der Werbepsychologie, du kannst o.k. sein, wenn
du dieses
oder jenes konsumierst, können sie oft nicht widerstehen. Sie müssen jedes nur
mögliche o.k.
erringen, um zu überleben.
Betroffene nehmen sich zumeist im gesamten Spektrum ihres Lebens als
unbefriedigt wahr.
Das, was sich auch problematisch auf ihre Beziehungen auswirkt, die Übertragung
der
Verantwortung des inneren Erlebens auf den Partner (Verschmelzung), spielt auch
in anderen
Lebensbereichen eine entscheidende Rolle. Betroffene gehen in der Regel davon
aus, dass
äußere Gegebenheiten für ihr Befinden verantwortlich sind, was sie dann davor
bewahrt, in die
gefürchtete Selbstauseinandersetzung zu gehen. Das verinnerlichte „nicht o.k.“
kann so auch
immer wieder als „du bist nicht o.k.“ nach außen delegiert werden, womit sowohl
das
Selbstbild, als auch die Lebensanschauung erhalten bleiben.
In der Hoffnung, ihr beständiges Unbefriedigtsein durch das Verändern äußerer
Umstände
beeinflussen zu können, neigen Betroffene dann häufig dazu, ihre beruflichen
Ziele zu
verändern (in einem anderen Beruf wäre ich erfolgreicher), permanent
herumzureisen (an
einem anderen Ort würde ich mich besser fühlen) oder promiskuitiv zu sein (mit
einem
anderen Partner würde ich endlich zur Ruhe kommen).
Betroffene setzen sich so oft rasend schnell neue Ziele, die sie dann ebenso
schnell wieder
verwerfen. Der Moment, in dem sie ihr neues Ziel fantasievoll avancieren,
enthält jede Menge
Erwartungen und Hoffnungen, die aber oft nicht realistisch hinterfragt werden
(eingeschränktes Erwachsenen-Ich). Das Bedürfnis nach Anerkennung, Erfolg oder
Bestätigung
(o.k. zu sein) ist dermaßen groß, dass allein die Emotionalität zählt, die im
Augenblick mit der
jeweiligen Zielstellung verbunden ist. Die Enttäuschung folgt spätestens dann,
wenn während
der neuen Ausbildung oder im neuen Job, die alte Leere und der Eindruck
unzureichend zu
sein, noch immer präsent sind. Ähnlich ist es mit Ortsveränderungen. Viele
Borderline-
Persönlichkeiten flüchten immer wieder aus der häuslichen Atmosphäre und
versprechen sich
von Ortswechseln auch eine Änderung ihrer Verfassung. Sie ziehen permanent um,
wechseln
Stadt oder Wohnung oder versuchen es mit ständigem Reisen.
Aber jede Befriedigung und jedes erreichte Ziel bringt nicht mehr, als eine
kurze Erleichterung,
ein kurzes Wohlgefühl, das sich nicht halten lässt. Die Erwartung, dass nun
alles gut wird,
erfüllt sich nicht. Auch im neuen Job gibt es die gleichen Probleme; der neue
Partner ist
genauso wie der alte; in der neuen Wohnung ist man auch nicht glücklicher und
das Kind ist
nur noch anstrengend.
Was folgt ist bittere Enttäuschung. Identitätsstarke Menschen, deren
Ich-Zustände klar
voneinander abgetrennt sind, können ihre Trauer und Enttäuschung annehmen und
verarbeiten oder den eigenen Anteil hinterfragen. Borderline-Persönlichkeiten
haben aber nicht
gelernt, sich zu trösten oder um etwas zu trauern. Im Gegenteil. Oft haben sie
verinnerlicht,
dass auf Schmerzen, noch drastischere Schmerzen folgen. Wenn z. B. ein
verängstigtes Kind
schreit, um auf sich aufmerksam zu machen und dann dafür bestraft wird, kann es
nicht lernen, mit seinem Kummer umzugehen. Es lernt nur, dass auf einen Schmerz ein
noch
größerer folgt. Es ist geradezu typisch für Borderline-Persönlichkeiten, dass
sie ihre Schmerzen
noch drastifizieren und andere mit einbeziehen, um so auch eine entsprechende
Spiegelung zu
erhalten.
Das Erwachsenen-Ich identitätsstarker Menschen ist in der Lage nach Ursache und
Wirkung zu
suchen. Es trägt Informationen zusammen und sucht Lösungswege, die dann auch als
Lernerfahrung abgespeichert werden können und in späteren Situationen helfen,
ähnliche Fehlentscheidungen zu vermeiden.
Die Verschiebung der Ich-Zustände bei der Borderline-Persönlichkeit im
Zusammenspiel mit der Abspaltung erdrücken jedoch das Erwachsenen-Ich, sodass die Fähigkeit Ursache und
Wirkung zu erkennen äußerst gering ist. Trauer und Enttäuschung werden
abgespalten, das
heißt auf das Objekt übertragen. Der Job war der falsche, der Partner unfähig,
das Kind ein
Monster. Der einzige Lösungsweg ist die Suche nach einem neuen Partner, einem
neuen Job,
vielleicht auch ein neues Kind ...
Letztendlich bleiben Borderline-Persönlichkeiten darauf fixiert, ihre erste
wichtigste
Entwicklungsphase der Spaltung überwinden zu wollen. Ihre Erwartungshaltung
bleibt davon
geprägt, dass etwas von außen (Mutter) es machen kann, dass im inneren Erleben
alles gut
wird. Es sind immer neue Wünsche und Erwartungen, die dabei entstehen, denn die
alte,
abgrundtiefe Leere, die dort ist, wo andere ein „Selbst-Bewusstsein“ entwickelt
haben, bleibt
leer und kann durch nichts im Nachhinein gefüllt werden. Für jeden erfüllten
Wunsch entstehen
10 neue. Partner, die sich in der Regel ja in einer verschmelzenden Beziehung zu
ihrer
Borderline-Persönlichkeit befinden, reagieren meist unangebracht angepasst. Sie
widersprechen selten, akzeptieren und unterstützen auch irrationale Ziele und
versuchen viel zu lange ihre unstillbaren Partner zufriedenzustellen. Nicht wenige verlieren so ihre Existenz.
Hinweis: Als Partner sollten Sie sich Ihres eigenen kindlichen „ich bin nicht
o.k.“ und der
daraus resultierenden Neigung, den Wünschen der Bezugsperson unhinterfragt zu
entsprechen, bewusst werden. Partner glauben aus ihrer Lebensanschauung heraus,
dann
vielleicht o.k. zu sein, wenn sie so funktionieren, wie andere es wünschen
(negativ,
angepasstes Kind-Ich). Womit diese, auf der Jagd nach ihrem o.k., genauso wenig
in der
Beziehung präsent sind, wie Betroffene. Nicht selten forcieren ihre coabhängigen
Tendenzen,
die Fehlentscheidungen und überzogenen Erwartungen der Betroffenen und bereiten
so erst
den Weg in katastrophale Krisen. Hilfreich ist hier allein ehrliche Reflektion.
Distanzieren Sie
sich von der Verlockung, sich auf eine weitere verführerische
Verschmelzungsrunde im
begeisterten Kind-Ich einzulassen. Zumal die aus einer Fehlentscheidung
resultierende
Enttäuschung in der Regel auch für den Partner schmerzhafte Konsequenzen nach
sich zieht
(fühle wie ich).
Nutzen Sie als Angehöriger Ihr Erwachsenen-Ich. Welche Konsequenzen hat das
Ziel, womit
muss gerechnet werden, wie lässt sich das finanzieren, was konkret wird von der
Zielstellung
erwartet? Betroffene konzentrieren sich in ihrer Motivation zumeist auf ihr
emotionales
(kindliches) Erleben, die Erwachsenenebene wird dabei oft nicht involviert, was
dann auch zu
massiven Enttäuschungen führt, die dann in der Verantwortung wieder äußeren
Gegebenheiten
zugeschrieben wird. Stellen Sie sich auch darauf ein, dass Sie für Ihre
kritische Betrachtung
und Ihr realistisches Hinterfragen nicht unbedingt eine positive Reflektion
erhalten. Im
Gegenteil. Kritische Einwände einer Bezugsperson schmälern die erhoffte
Idealisierung des
neuen Ziels. Ähnlich wie bei der Partnerwahl erhoffen sich die Betroffenen ja
eine Auflösung
ihrer Problematik durch das Erreichen eines neuen Ziels. Da der Partner durch
seine Kritik auch
eine gewisse Eigenständigkeit zeigt, kann er durchaus auch als bedrohlich
wahrgenommen
werden. Kritische Impulse werden dann oft wie Angriffe abgewehrt. Es ist für
Angehörige oft
sehr schwer, nicht in die Euphorie Betroffener einzustimmen, die ein neues Ziel
gefunden
haben. Zumal jegliche Kritik oder Zurückhaltung von diesen meist als „Angriff“
wahrgenommen
wird und ein „schwarz besetzen“ mit ausagierendem Verhalten, Kontaktabbrüchen
und
Abwertungen droht. Wenn Sie aber den Mut und die Stärke haben, nicht aus Angst
vor
Zurückweisung alles abzunicken, was der/die Betroffene plant, sind sie ihm/ihr
eine
tatsächliche Unterstützung. Und darauf kommt es schließlich an.
Als unangebracht und gefährlich, nehme ich hier das Verhalten der meisten
Partner im Umgang mit den gescheiterten Zielen ihrer Borderline-Persönlichkeit wahr. Viele Partner neigen dazu, die Verantwortung für deren Fehlentscheidung zu übernehmen und dann Kredite zu tilgen, Reisen zu stornieren, Kündigungen zu schreiben ... DieKonsequenzen der Fehlentscheidungen Betroffener sollten von Angehörigen auf KEINENFall getragen werden.
Erwachsenes Verhalten zeigt sich gerade durch die Fähigkeit, Verantwortung für
getroffene Entscheidungen, aber auch Ziele oder Pläne zu übernehmen und dann auch die
Konsequenzen zu tragen. Hier neigen coabhängige Partner dazu, sich selbst ein Bein zu
stellen. Sie empfinden
es als unerträglich, immer wieder für alles verantwortlich gemacht zu werden,
reißen aber jede
Verantwortung an sich. Letztendlich hemmen sie damit massiv das bereits
beeinträchtigte
Erwachsenen-Ich der Borderline-Persönlichkeit und verhindern so die Reifung
seiner
Persönlichkeit.
 InhaltsverzeichnisTransaktionsanalytisches Grundwissen
InhaltsverzeichnisTransaktionsanalytisches Grundwissen
in Bezug auf die Borderline-Persönlichkeitsstörung
©Manuela Rösel
Inhaltsverzeichnis – Teil I
1. Grundsätzliches
Die Borderline-Persönlichkeitsstörung
Typische zerstörerische Verhaltensweisen
2. Das Konzept der Transaktionsanalyse
Wer bin ich
Die Transaktionsanalyse
Ich-Zustände
Das Streicheln und seine Bedeutung
Lebensanschauungen
Die Analyse von Transaktionen
Spiele der Erwachsenen
Das Rabattmarkensammeln
Inhaltsverzeichnis – Teil II
Vorwort
1. Ursachen der Borderline-Störung
Die natürliche Phase der Spaltung
Störungen im Spaltungsprozess
Mögliche Ursachen der Borderline-Störung
Wenn Menschen zu viel fühlen
Hochsensibilität und Borderline
Das eine vom anderen unterscheiden
Wir bleiben streichelhungrig
2. Transaktionsanalytische Betrachtung der Borderline-Störung
Die Lebensanschauung der Borderline-Persönlichkeit
Die Anordnung der Ich-Zustände
3. Spiele der Borderline-Persönlichkeiten
Tumult
Ich Arme/r
Schwarzer Peter
Mach mich fertig
Lösungsmöglichkeiten
Wie man Spiele abwehrt oder beendet
4. Borderline verstehen
Typische Borderline-Verhaltensweisen verstehen
Faszination Sexualität
Wenn man den Partner teilen muss
Perverse Kommunikation
Wird es mit dem Alter besser?
Ist Borderline heilbar?
Borderliner sind o.k.!
Schluss
Quellenverzeichnis und Literaturempfehlungen
Mögliche Hinweise auf eine hochsensible Persönlichkeit.
Autorenangaben
|
|
| Erschienen: 2012 |
| Verlag: Starks-Sture-Verlag |
ISBN-10: 3939586196
ISBN-13: 978-3939586197
|
|
|
|
|
| "Wenn lieben immer wieder weh tut" |
| Partner in der Borderline-Beziehung
|
| In "Borderline verstehen" setze ich mich mithilfe der Transaktionsanalyse, mit den typischen Persönlichkeitsmerkmalen und Verhaltensweisen Betroffener auseinander. In "Wenn lieben immer noch weh tut" stehen auf der gleichen Ebene deren Partner und deren typische Wesensmerkmale im Mittelpunkt. Dieses Buch beschäftigt sich somit vorrangig mit dem Persönlichkeitshintergrund der Menschen, die sich in einer Beziehung zu einer Borderline-Persönlichkeit befinden oder sich aus dieser gelöst haben. Unabhängig davon, ob Sie in Beziehung zu einem/r Betroffenen sind, oder einer derartige Bindung hinter sich gelassen haben, können Sie Ihre Erfahrungen nur dann sinnvoll verarbeiten, wenn Sie selbstreflektierend eigene Anteile erkennen, verstehen und bearbeiten ...
|
 Leseprobe |
Leseprobe |
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
 LeseprobeWenn lieben immer wieder weh tut
LeseprobeWenn lieben immer wieder weh tut
Partner in der Borderline-Beziehung
© Manuela Rösel 2013
Der Partner und sein Erleben im Beziehungsverlauf
Unabhängig von den für Borderline-Beziehungen charakteristischen Phasen, auf die ich später noch
eingehen werde, zeigen Partner im Beziehungsverlauf deutlich fassbare Erlebens-
und Verhaltensmuster, die in den meisten derartigen Beziehungen immer wieder
erkennbar sind. In den überwiegenden Fällen kommt es zu folgenden Abläufen:
1. Es fühlt sich einfach perfekt an
Die Borderline-Persönlichkeit wirkt auf ihre zukünftigen Partner begehrenswert und faszinierend. Viele Partner fühlen sich
gleichzeitig angezogen, spüren aber mitunter auch intuitiv, dass sie einen
Fehler begehen, wenn sie sich einlassen. Diese innere Warnung wird zumeist aber
abgewehrt. Mit extrem viel Offenheit geben sich die Partner verletzlich hin und
berichten vertrauensvoll von Dingen, die sie noch niemandem anvertraut haben.
Bedingungslos lassen sie sich in die euphorisierende gegenseitige Idealisierung
hineinfallen. Die Nähe des anderen wird als einmalig erlebt. Es existieren viele
Gemeinsamkeiten. Ähnliche Ansichten, Meinungen und Interessen, lassen den
Eindruck von „Seelenverwandtschaft" entstehen. Oft fühlen Partner sich zum
ersten Mal in ihrem Leben ganz und gar richtig, angenommen und absolut o.k. Ihre
eigene permanente unterschwellige Angst, verlassen oder zurückgewiesen zu
werden, verliert sich. Es entsteht ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit,
wie es selten oder noch nie erlebt wurde.
Sexualität spielt in dieser Phase oft
eine wesentliche Rolle. Sie wird als sehr intensiv und einmalig wahrgenommen. In
dieser Phase der Beziehung erleben sich die meisten noch autark und
abgrenzungsfähig, zumal sie noch nicht in dem Ausmaß kontrolliert und eingeengt
werden wie im späteren Verlauf.
2. Erste Irritationen
Es entstehen erste Konflikte und/oder Distanzen, die nicht wirklich verstanden und verarbeitet werden. Die Partner reagieren oft irritiert und überfordert. Hilflos versuchen
sie, den ursprünglichen Zustand der ersten idealen Zeit wieder herzustellen und
damit auch das einmalige Gefühl von Geborgenheit und Nähe. Am liebsten würden
sie die unangenehmen Veränderungen einfach ignorieren. Sie sind vorsichtiger,
beginnen ihre Aufmerksamkeit mehr auf den anderen, als auf sich zu richten,
versuchen, Konflikte zu vermeiden und eigene Interessen zu unterdrücken. Trotz
ihrer Bemühungen und Selbsteinschränkungen kommt es zu immer neuen
Auseinandersetzungen, was dazu führt, dass sie sich noch mehr anpassen. Auf der
sexuellen Ebene kann es zu Grenzüberschreitungen kommen, die oft noch toleriert,
mitunter auch neugierig angenommen werden. Hier kann sich durchaus auch eine
sexuelle Abhängigkeit entwickeln.
Substanzabhängige Borderline-Persönlichkeiten versuchen, ihre Partner in die
Sucht mit einzubeziehen, mitunter wird dem - aus Angst vor Auseinandersetzungen
und/oder Neugier - auch nachgegeben.
3. Die Achterbahnfahrt beginnt
Die intimen, vertraulichen Informationen, mit denen die Partner sich anfangs in ihrer ganzen Verletzlichkeit den Betroffenen anvertrauten, werden nun oft gegen sie gerichtet (dein Vater hat sich umgebracht – kein Wunder bei dieser Tochter). Für die
meisten Partner eine Erfahrung, die sie zutiefst destabilisiert. Das
symptomatische Verhalten des/der Betroffenen ist nun wieder vollständig präsent.
Extreme Wutausbrüche, verbale und/oder körperliche Gewalt gegen andere oder die
eigene Person, Kontaktabbrüche und erneuter Kontakt, emotionale Erpressung und
dramatische Inszenierungen hinterlassen beim Partner ein diffuses Chaos, Angst
und Zerrissenheit. Die symbiotische Bindungsebene der projektiven Identifikation
(ich bin du - und du bist ich) zieht ihn, ohne dass er sich darüber bewusst ist,
in den gleichen Erlebnisstrudel, dem auch die Borderline-Persönlichkeit
ausgesetzt ist (Instabilität). Die mehrfach erlebten Kontaktabbrüche und
Übergriffe haben beim Partner inzwischen überwältigende Gefühle von
Verlassenheit, Hoffnungs- und Sinnlosigkeit hinterlassen. Bei jeder
darauffolgenden „Versöhnung" folgte ein ebenso überwältigendes Gefühl der
Erleichterung, das Leben hatte wieder einen Sinn (Achterbahnfahrt). Der
Borderline-Partner ist nun selbst ausgeprägt instabil und zumeist massiv
retraumatisiert. Sein Kind-Ich hat ganz die Kontrolle übernommen. Durch
bedingungslose Anpassung, versucht er, jedem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Er
beginnt, nicht nur die Verantwortung für Konflikte zu übernehmen, sondern auch
die Verantwortung für die Borderline-Persönlichkeit (Überfürsorglichkeit,
co-abhängiges Verhalten). Es kommt immer häufiger zu Inszenierungen und
Übergriffen, die zum Teil auch lebensgefährlichen Charakter tragen (riskantes
Autofahren, gefährliche Sportarten), mitunter werden auch die Kinder mit
involviert. Auf der sexuellen Ebene kann es zu einem Abbruch kommen, auch die
Entwicklung extremer Praktiken (sado-masochistisch) ist möglich. Noch immer ist
der Partner auf das Erleben der ersten, idealen Zeit fixiert und versucht, sich
die schmerzhaften Erfahrungen der letzten Tage, Wochen, Monate so zu erklären,
dass er die Beziehung aufrecht erhalten kann. Dabei entlastet er den/die
Betroffene/n, indem er Erklärungen für deren/dessen Verhalten findet (er/sie war
ja auch überlastet), und sucht nach Belastungspunkten für sich (das hätte ich
nicht sagen, denken, fühlen dürfen). Einige Partner lösen sich zu diesem
Zeitpunkt aus der Beziehung. Die meisten jedoch versuchen, jeden Impuls, der sie
zu einer Entscheidung gegen die Beziehung drängt, abzuwehren.
4. Ich erkenne mich nicht wieder
Die Partner verlieren immer mehr ihre Selbstbestimmtheit und
den Zugang zu ihrem Wertesystem. Sie lösen sich aus ihren sozialen Kontakten,
isolieren sich vollständig, um ganz für die Borderline-Persönlichkeit verfügbar
zu sein. Die nun immer häufiger auftretenden Krisen und
Double-Bind-Situationen überfordern sie maßlos. Sie sind nicht mehr in der Lage,
die Widersprüchlichkeit ihrer Borderline-Bezugsperson zu erkennen und sich den
gegensätzlichen Forderungen zu entziehen. Nach mehrfachen Kontaktabbrüchen und
emotionalen und/oder körperlichen Gewalterfahrungen ist ihre Verlustangst so
überwältigend, dass sie jede Selbstständigkeit aufgegeben haben. Mitunter
bezeichnen einige Partner zu einem späteren Zeitpunkt, diese Erfahrung als
„Gehirnwäsche". Als interessantes Phänomen kann in dieser Phase der Beziehung
beobachtet werden, dass es viele Partner gibt, die sich so vollständig mit der
Borderline-Persönlichkeit identifizieren, dass sie deren spaltende
Verhaltensweisen teilweise übernehmen. Freunde, die sich „gegen" die Beziehung
stellen, und versuchen die Selbstfürsorge des Partners zu aktivieren, werden
abgestoßen und negativ besetzt. Übergriffe auf involvierte Kinder werden nicht
nur toleriert, sondern manchmal auch selbst inszeniert. Zu diesem Zeitpunkt ist
die alte kindliche Angst bereits dermaßen reaktiviert, dass es nur noch um den
Selbstschutz geht, dem alles, selbst die eigenen Kinder, geopfert werden.
5. Nichts ist ohne Schmerz
Es kommt zu Bestrafungsritualen, wenn Partner den (oft
unerfüllbaren) Erwartungen der Borderline-Persönlichkeit nicht entsprechen.
Dabei werden oft Kontrollspiele genutzt, bei denen der Partner massiven
Übergriffen ausgesetzt ist (wage es nicht, zu telefonieren, du gehst nicht aus
dem Haus ...). Wehrt der Partner sich, wird er bestraft, wehrt er sich nicht,
wird das „Spiel" verschärft. Mitunter hat der/die Betroffene sich bereits auf
einen neuen Beziehungspartner eingelassen. Partner erleben sich zu diesem
Zeitpunkt als vollständig abgewertet. Alles an ihnen wird als schlecht und
falsch reflektiert - die Art, wie sie atmen, essen oder sich bewegen. Aus
eigener Kraft können sie sich kaum noch lösen. Zunehmende Grenzüberschreitungen
der Borderline-Persönlichkeit ( lern doch mal meine neue Freundin kennen) oder
extrem gewalttätige und gefährliche Inszenierungen rauben ihnen die letzten
Kräfte. In den meisten Fällen werden die Partner, nicht ohne mit massiven
Schuldzuschreibungen überhäuft zu werden, zu diesem Zeitpunkt verlassen. Häufig
brechen sie aber auch zusammen und müssen klinisch (stellvertretend für die
betroffene Borderline-Persönlichkeit) behandelt werden. Kommt es erst an dieser
Stelle zu einer vom Partner ausgesprochenen Trennung, kann das, in einigen
Fällen, gefährliche Konsequenzen haben. ...
 Inhaltsverzeichnis„Wenn lieben immer noch weh tut“
Inhaltsverzeichnis„Wenn lieben immer noch weh tut“
Partner in der Borderline-Beziehung,
sich selbst und die Beziehung mit Hilfe der Transaktionsanalyse verstehen
© Manuela Rösel
Vorwort
1. Das Konzept der Transaktionsanalyse
Wer bin ich?
Die Transaktionsanalyse
Ich-Zustände
Das Streicheln und seine Bedeutung
Lebensanschauungen
Die Analyse von Transaktionen
Spiele der Erwachsenen
Das Rabattmarkensammeln
2. Der „typische“ Partner einer Borderline-Persönlichkeit
DEN Borderliner gibt es nicht!
Das Profil des „typischen“ Partners
Bindung – ohne sie, sind wir leer
Das verletzte Kind
Borderline-Beziehung und Selbstheilung
Der systemische Hintergrund des typischen Partners
3. Der transaktionsanalytische Hintergrund des typischen Partners
Die Lebensanschauung der Partner-Persönlichkeit
Die Anordnung der Ich-Zustände
Überlebensmechanismen
Die Übereinstimmung der Lebensanschauungen
4. Der typische Partner in der Beziehung
Der Partner und sein Erleben im Beziehungsverlauf
Die narzisstische Persönlichkeitsstörung und ihre Rolle in Borderline-Beziehungen
Täter und Opfer
Wenig hilfreich - das Helfersyndrom
Das Drama verstärken durch Coabhängigkeit
Das perfekte Pendant – Co-Borderline
Instabilität als ein Hauptmerkmal der Borderline-Störung
5. Die Phasen einer Borderline-Beziehung
Die Idealisierungsphase - endlich angekommen
Die Nähe und Distanzphase - die Achterbahnfahrt beginnt
Die entwertende Phase - Absturz ins Nichts
6. Die Spiele des typischen Partners
Warum spielen wir?
Passive Aggressivität im Spiel
Gerichtssaal
Warum nicht – ja aber ...
Wenn du nicht wärst ...
Ich versuche nur, dir zu helfen
Spiele abbrechen
7. Raus aus dem Dilemma
Der Partner als Therapeut
Haben Borderline-Beziehungen eine Chance?
Was bei Trennungen von einer Borderline-Persönlichkeit zu beachten ist
Loslassen
Warum der typische Partner nicht oder nur schwer loslassen kann
Was tun wir, wenn wir nicht loslassen
Was tun wir, wenn wir loslassen
Die Beziehung danach – Erwartungshaltung und Realität
8. Hilfe zur Selbsthilfe
Trübungen aufheben und das Erwachsenen-Ich stärken
Dem inneren Kind gute Eltern sein
Vom Umgang mit inneren Konflikten
Imagination als Ressource
Schluss
Arbeitsmaterial
Quellenverzeichnis und Literaturempfehlungen
|
|
| Erschienen: Neuerscheinung Mai 2014 |
| Verlag: Starks-Sture-Verlag |
ISBN-10: 3939586137
ISBN-13: 978-3939586135
|
|
|
|
|
| "Lieben leicht gemacht" |
| Ein Kartenset zu den Themen Selbstwahrnehmung, Konflikte und Beziehungen
|
Auf der Basis der Gewaltfreien Kommunikation, habe ich diese Intervention entwickelt, um meinen Klienten die Möglichkeit zu geben, mit den vielfach verdrängten und kaum noch bewussten eigenen Bedürfnissen wieder in Kontakt zu kommen. Die dabei stattfindende Auseinandersetzung mit den ganz individuellen Werten und dem Umgang mit ihnen, ermöglicht Klarheit und somit auch die Basis für die Fähigkeit zu handeln. Auf Grund der besonders guten Resonanz auf diese Arbeit, habe ich mich entschlossen, diese Intervention tief gehender auszuarbeiten.
Der Verlag zum Buch:
Missverständnisse und Probleme in Beziehungen entstehen, weil wir nicht angemessen miteinander kommunizieren. Wir erwarten vom Partner, dass er unsere Bedürfnisse, sogar unausgesprochene, erfüllt. Gleichzeitig bemühen wir uns, es dem Partner Recht zu machen. Dabei stellen wir oft unsere eigenen Wünsche auf Kosten unserer Individualität zurück. Die Folgen sind Enttäuschung und Frustration im Umgang miteinander. Um eine erfüllte Beziehung zu führen, ist es wichtig, wieder zum eigenen Selbst und den persönlichen Werten zu finden sowie der Falle gegenseitiger Schuldzuweisungen zu entfliehen. Voraussetzung dafür sind das Erkennen und Achten unserer eigenen Bedürfnisse und Gefühle. Erst, wenn wir diese wahrnehmen und anerkennen, werden wir auch die unseres Partners annehmen können und in der Lage sein, eine befriedigende Beziehung zu leben. Die psychologische Beraterin und Bestsellerautorin von 'Wenn lieben weh tut' Manuela Rösel gibt, inspiriert von Marshall M. Rosenberg, dem Begründer der 'Gewaltfreien Kommunikation', Tipps und Einsichten aus ihrer praktischen Arbeit. Mit dem von ihr entwickelten und in der Praxis erfolgreich erprobten Kartenset erhalten Sie wertvolle Erkenntnisse darüber, was Ihnen und Ihrem Partner wirklich wichtig ist. Sie lernen einen behutsamen Umgang mit sich selbst und Ihrem Partner mit dem Ziel des gegenseitigen Verstehens und gemeinsamen Wachsens. Das Kartenset 'Lieben leicht gemacht' werden Sie immer wieder verwenden können! Egal, ob Sie sich oder Ihren Partner besser verstehen und kennenlernen wollen oder für Konflikte mit sich oder Anderen Lösungen suchen. Hier finden Sie ein hilfreiches Werkzeug.
|
 Leseprobe |
Leseprobe |
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
 Leseprobe„Lieben leicht gemacht“
Leseprobe„Lieben leicht gemacht“
Starks-Sture-Verlag – München
Liebe und Bedürfnisse
Was hat nun dieser Versuch einer Annäherung an den Komplex Liebe mit der Ihnen
vorliegenden Intervention zu tun? An dieser Stelle komme ich noch einmal auf die
Gewaltfreie
Kommunikation zurück, für deren Begründer Marshall Rosenberg die Liebe ein
Grundbedürfnis
des Menschen ist, dem weitere Bedürfnisse untergeordnet sind. Rosenberg
differenziert dabei,
in Übereinstimmung mit den vielschichtigen Auffassungen, dass Liebe der
Lebenserhaltung und
–entwicklung dient, eben durch die Befriedigung jener Bedürfnisse, die diesem
Grundbedürfnis
untergeordnet sind. Hier findet sich nun auch eine Erklärung dafür, warum jeder
Mensch eine
ganz eigene Definition des Begriffes Liebe hat.
„Liebe“ ist für jeden Menschen ein ganz individueller Komplex aus Gefühlen
und
unterschiedlichen Bedürfnissen.
Auch wenn diese in ihrer Gesamtheit für jeden Menschen zur Liebe dazugehören, so
besitzt
doch jeder Mensch dabei seine ganz eigenen Prioritäten. Diese Prioritäten
ergeben sich zumeist
aus erlebten Defiziten. Wenn das Kind zuwenig Nähe und Aufmerksamkeit erfahren
hat, wird
es als Erwachsener eben jene Defizite im Rahmen einer Heilung und Entwicklung
ausgleichen
wollen. Da jeder Mensch über ganz unterschiedliche Erfahrungen verfügt, ist auch
sein daraus
resultierendes Defizit sehr individuell. Für den einen kann Beständigkeit die
oberste Priorität
haben, für einen anderen steht Abwechslung an erster Stelle. Auch die Wertigkeit
der
Sexualität ist ganz unterschiedlich ausgeprägt und ergibt sich für viele
Menschen erst aus
anderen Bedürfnissen heraus. Es ist also für jeden äußerst wichtig, Klarheit
darüber zu
gewinnen, welche Bedürfnisse Priorität haben und genau hier findet die
beiliegende
Intervention ihren Einsatz.
Auf jedem der beiliegenden Karten finden Sie ein Bedürfnis, welches der Liebe
zugeordnet
werden kann. Aufmerksamkeit, Nähe, Respekt, Wertschätzung, Zärtlichkeit,
Sexualität…. Die Auseinandersetzung mit der Frage „was brauche ich eigentlich genau in einer Liebesbeziehung?“, ist ein erster Schritt sich selbst differenzierter
wahrzunehmen.
Sprachlosigkeit ist einer der erfolgreichsten Stolpersteine in unseren
zwischenmenschlichen
Beziehungen. Wenn ich jedoch weiß, was ich brauche, kann ich mich auch klar
ausdrücken.
Nicht nur dem Partner, sondern in erster Linie mir selbst gegenüber. Wenn ich
mir bewusst
mache, dass Wertschätzung eines meiner prioritären Bedürfnisse ist, muss ich mir
auch die
Frage stellen können, inwieweit ich in der Lage bin, mich selbst und andere zu
wertschätzen?
Auf diese konkretere Arbeit mit den Karten im Bereich der Auseinandersetzung mit
der eigenen
Bedürfnishierarchie komme ich zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal zurück.
Einsatzmöglichkeiten
Die vorliegende Intervention ermöglicht eine vielschichtige Auseinandersetzung
mit der eigenen Persönlichkeit, aber auch der des Partners. Ein Einsatz dieser
Intervention zeigt sich als besonders hilfreich, wenn…:
» der Zugang zu eigenen Bedürfnissen fehlt, z.B. für Partner in gestörten
Beziehungen, die co-abhängige Tendenzen zeigen.
» Selbstunsicherheit oder mangelndes Selbstbewusstsein die eigene Handlungsfähigkeit einschränken.
» das Bewusstsein für das eigene Ich (Identität - was macht mich aus, wer bin
ich?) geschärft werden soll
» ich mich intensiver mit meiner Beziehung auseinandersetzen möchte.
» ich meinen Partner besser kennen oder verstehen lernen möchte.
» ich bestehende Konflikte für mich klären möchte, um mich im Sinne einer
Klärung für mich selbst wieder orientieren zu können.
» ich gemeinsam mit meinem Partner einen Konflikt klären möchte.
Ziel der Interventionsvarianten...
...ist das bewusste Wahrnehmen und Auseinandersetzen mit dem, was Ihre
Lebendigkeit
ausmacht. Ihre Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt ihres Lebens, wenn sie ihnen
nur
unzureichend zugänglich sind, sind Sie nur eingeschränkt oder kaum in der Lage
für sich (und Ihre Beziehungen) zu sorgen. Viele Menschen kompensieren ihre nicht wirklich wahrgenommenen Defizite, durch Ersatzbedürfnisse wie Konsum, Medienbissbrauch,
übermäßiges Essen, betäuben ihre innere Leere durch Alkohol und Drogen oder
flüchten von einer Beziehung in die nächste.
Dahinter steht letztendlich ein unzureichender Kontakt zu sich selbst,
Hilflosigkeit im Umgang
mit sich und anderen und in der Konsequenz eine fehlende oder unzureichende
Orientierung im
Handeln. Sinnvoll handlungsfähig, sind Sie aber nur dann, wenn Sie in der Lage
sind, sich mir
mit dem, was Sie fühlen und denken, Klarheit und Orientierung zu verschaffen.
Genau hier setzt die Intervention ein. Ob Sie sich einfach nur mit den
Bedürfnisbegriffen
vertraut machen, sich mit ihren Inhalten auseinandersetzen oder sich durch das
anordnen der
Karten einen tiefgehenderen Einblick in die eigene Persönlichkeit ermöglichen,
Sie haben die
Chance, sich in Ihrer Selbstwahrnehmung zu stärken! Sie befähigen sich selbst,
klarer und
sinnvoller zu handeln, besser für sich und Ihre Beziehungen zu sorgen. ...
...
 Inhaltsverzeichnis „Lieben leicht gemacht“
Inhaltsverzeichnis „Lieben leicht gemacht“
Starks-Sture-Verlag – München
| Inhaltsverzeichnis |
Seite |
| Vorwort |
4 |
| Die Grundlagen |
5 |
| Die 4 Phasen der Gewaltfreien Kommunikation |
5 |
| Vom Umgang mit „negativen“ Gefühlen |
6 |
| Die traurige Realität |
7 |
| Was ist das - Liebe? |
7 |
| Liebe und Bedürfnisse |
9 |
| Einsatzmöglichkeiten |
9 |
| Ziel der Interventionsvarianten |
10 |
| Varianten der Intervention und ihre Ausführung |
11 |
| Selbstklärung |
11 |
| Einfache Auseinandersetzung mit Bedürfnissen |
11 |
| Identifikation von Bedürfnisprioritäten |
13 |
| Umfangreiche Bedürfnisanordnung |
16 |
| Intrapersonelle (innere) Konflikte |
17 |
| Beziehungsklärung |
19 |
| Achtung |
19 |
| Einfache Auseinandersetzung mit Bedürfnissen |
19 |
| Identifikation von Bedürfnisprioritäten |
20 |
| Umfangreiche Bedürfnisanordnung |
21 |
| Interpersonelle (zwischenmenschliche) Konflikte |
21 |
| Umgang mit den Vorlagen |
23 |
| Schluss |
24 |
| Quellenverzeichnis |
25 |
|
|
| Erschienen: November 2007 |
| Verlag: Starks-Sture-Verlag |
ISBN-10: 3939586072
ISBN-13: 978-3939586074
|
|
|
|
|
| "Wie der Falter in das Licht" |
| Selbstakzeptanz in der Borderline-Beziehung
|
| Der Verlag zum Buch: Partner in einer Beziehung mit einer Borderline-Persönlichkeit sind immer großem Druck und emotionalen Belastungen ausgesetzt, da Teil dieser Persönlichkeitsstörung Idealisierung und Abwertung in unangemessenem Maß gelebt wird. Die Autorin vom Bestseller "Wenn lieben weh tut" zeigt nun in diesem Buch auf, wie sich Partner durch Selbstakzeptanz stärken können. Sie analysiert typische Fallbeispiele und belegt anhand dessen, dass es immer wiederkehrende Muster gibt, die einen Menschen in der Borderline-Beziehung hilflos verharren lässt. Manuela Rösel zeigt in Ihrem Selbsthilfebuch effektive Lösungsmöglichkeiten auf, die Betroffene sofort und einfach umsetzen können. Dieses Buch ist für jeden Betroffenen ein Muss und ist auch zur Aufarbeitung einer bereits beendeten Beziehung sehr geeignet.
|
 Leseprobe |
Leseprobe |
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
 Leseprobe„Wie der Falter in das Licht“
Leseprobe„Wie der Falter in das Licht“
Selbstakzeptanz in der Borderline-Beziehung
Starks-Sture-Verlag – München
ISBN 978-3-939586-02-9
© Copyright
Konsequenzen für Partner nach einer Trennung
Das Scheitern einer Beziehung zu einer Borderline-Persönlichkeit, bleibt oft nicht ohne tiefgreifende Konsequenzen für den zurückbleibenden Partner. Unabhängig davon, wer die Trennung ausspricht, beginnt für diesen eine Zeit der völligen Neuorientierung. Zumeist zeigt
ein Partner in der Borderline-Beziehung u. a. folgende Verhaltensweisen:
» Ständiges, genaues Beobachten des Betroffenen, um mögliche Gefahren rechtzeitig zu
erkennen.
» Bewusstes vermeiden von Konflikten, durch angepasstes Verhalten.
» Ignorieren, herabsetzen oder verdrängen eigener Gefühle und demzufolge auch das
» Ignorieren eigener Bedürfnisse und Wünsche.
» Permanente innere Auseinandersetzung mit Verantwortungsübergaben und
Schuldzuweisungen.
» Dulden und Ertragen von Herabsetzungen, Übergriffen und Erniedrigungen.
» Auf sich selbst ausgeübter massiver Druck, alles richtig machen zu wollen, um keinen
Anlass für übergriffiges Verhalten zu geben...
Derartiges Verhalten erfordert die Distanzierung vom Selbst. Sich in der Beziehung
aufzugeben, wird aus Hilflosigkeit heraus, als der einzige Weg wahrgenommen, die Beziehung
zu erhalten. Jeder Preis wird gezahlt, oft jeder Schmerz und jede Erniedrigung akzeptiert, um
das Verlassenwerden zu vermeiden. Dieses Verhalten entspricht ganz dem eines Kindes, das
seinen Bezugspersonen ausgeliefert ist und steht aus dem Hintergrund der
Persönlichkeitsstruktur des Partners, auch in direktem Zusammenhang mit dem aktuellen
Beziehungsverhalten.
Wenn die Bindung dann doch zerbricht, ist der zurückbleibende Partner oft völlig entwurzelt.
Das, was seinen bisherigen Lebensmittelpunkt ausmachte und sein ganzes Denken, Fühlen und
Sein beanspruchte, ist nicht mehr Teil seines Lebens. Zurück bleiben Emotionen wie totale
Leere und Angst. Der Eindruck, versagt zu haben, lässt Scham und das Gefühl der
Wertlosigkeit entstehen und aus der Gesamtheit dieses Fühlens und Denkens, entsteht die
Annahme, nie mehr eine erfüllende Partnerschaft eingehen zu können. Diese Phase kommt
einem völligen Zusammenbruch nahe, das Ausmaß des Verlustes, ist für Außenstehende nur
schwer nachvollziehbar. Leere, Angst, Scham und angenommene Wertlosigkeit – die Projektion
der Borderline-Symptomatik auf den Partner, ist auch nach der Trennung beängstigend aktiv.
Das Ende einer Bindung zu einer Borderline-Persönlichkeit, ist mit einem „normalen“
Beziehungsende nicht zu vergleichen. Die beständige emotionale Fixierung auf den Partner,
diente zwar einerseits einem scheinbaren Selbstschutz, ermöglichte aber auch eigenen
Grundannahmen, wie z. B. „Wenn ich mich anpasse, werde ich dafür geliebt“, zu entsprechen.
Die Beziehung zu einem Borderline-Partner, erscheint daher häufig als Sinn des Lebens,
welcher nach der Trennung verloren geht.
Je länger die Beziehung andauerte, je mehr der Partner den Bezug zum eigenen Ich verloren
hat, desto intensiver wird das so wahrgenommen. Dies geht mitunter so weit, dass sich beim
zurückbleibenden Partner nach der Trennung selbst Borderline-Strukturen bemerkbar machen.
Das Anpassen an die Achterbahnfahrt der Gefühle des betroffenen Partners, bleibt nicht ohne
Folgen. Impulsive Stimmungsschwankungen; drastische, emotionale Handlungsweisen zur
Durchsetzung von Bedürfnissen; extreme Verlustängste; totale Hilflosigkeitsgefühle und
emotionale Überflutungen, gehören zu den Auswirkungen. Dies ist ein durchaus logischer
Prozess, denn eben das Anpassen an die Persönlichkeitsmerkmale des betroffenen Partners,
ermöglichte ja den vermeintlichen Selbsterhalt an dessen Seite.
Im Grunde genommen haben die schwerwiegenden Konsequenzen einer Trennung, also nur
bedingt mit dem Verlust des von Borderline betroffenen Partners zu tun. Tatsächlich geht es
hier um die Persönlichkeit des Partners selbst. Aus einem Komplex eigener Strukturen heraus,
wie z. B. ein geschwächtes Selbstbild oder einen ängstlich-ambivalenten Bindungsstil, zeigte
sich, ähnlich wie bei dem Betroffenen, ein verzweifeltes Bemühen, das Verlassenwerden zu
vermeiden. Auch und gerade um den Preis der Selbstleugnung, denn eben diese Art der
Selbstfürsorge war vertraut. Trotzdem konnte das innere Kind des Partners die Angst nie
verwinden, die Zuwendung seiner geliebten Bezugspersonen jederzeit zu verlieren. Es hat die
Erfahrung gemacht nur wenig Einfluss darauf zu haben und trotz Selbstleugnung, nur bedingt
Zuwendung zu erhalten. Das Trauma des Kindes – trotz aller Mühen immer wieder
zurückgewiesen zu werden – wiederholt sich und soll, im Sinne der Selbstheilung auch
wiederholt werden. Wie es für unverarbeitete traumatische Erfahrungen typisch ist, bleiben die
dazugehörigen Emotionen, wie Schmerz, Angst oder Trauer immer im gleichen Ausmaß aktiv,
wie sie auch in der erlebten traumatischen Situation erfahren wurden. Der Komplex
schmerzhafter Gefühle um den jetzigen Verlust, vermischt sich mit den einmal erlebten, die im
Zusammenhang mit Zurückweisungen oder Verlassenwerden bereits erfahren wurden.
Da die Zuwendung seiner Bezugspersonen für ein Kind einmal lebensnotwendig war, erfährt es
den Entzug oder die Distanzierung aktueller Bindungspartner als vernichtend und
lebensbedrohlich. Alte unverarbeitete Erfahrungen vermischen sich mit dem aktuellen Erleben
des Erwachsenen, der von seinem Partner getrennt wird.
Für sich selbst oft völlig unerklärlich, empfindet er den Verlust wie ein inneres Sterben....
 Inhaltsverzeichnis„Wie der Falter in das Licht“
Inhaltsverzeichnis„Wie der Falter in das Licht“
Starks-Sture-Verlag – München
1. Prägungen und deren Konsequenzen
• Vorwort
• Klassifizierung nach DSM IV, sowie typische Borderline-Verhaltensweisen
• Gewaltfreie Kommunikation
• Wirklich hilflos?
• Erziehung – Beziehung
• Glaubenssätze
• Schicksal?
• Modelle und Schemata
• Bindungsstile
• Bin ich an einen Bindungsstil gebunden?
• Ich fall immer auf die/den Falsche/n rein
• Selbstheilung
• Wer ist „Falsch“ und wer „Richtig“
• Der Stellenwert der Diagnose
• Was hat die Borderline-Problematik meines Partners mit mir zu tun?
• Warum komme ich da nicht raus?
2. Reale Geschichten - direkt aus dem Leben
• Mareike T., 36 Jahre, Unternehmensberaterin, ehemalige Partnerin
• Andreas M., 30 Jahre, freischaffender Journalist, ehemaliger Partner, ein Kind
• Jeanette D., 38 Jahre, Geschäftsführerin, ehemalige Partnerin, ein Kind
• Stefan S., 47 Jahre, Angestellter, ehemaliger Partner
3. Was offensichtlich ist
• Eine ganz natürliche Entwicklung
• Erwachsen und nun?
• Wie kann ich das umsetzen?
• Gemeinsamkeiten
• Wann sollte ich die Beziehung beenden?
• Was Sie nach dem Scheitern der Beziehung auf keinen Fall tun sollten...
• Konsequenzen für Partner nach einer Trennung
• Auswege
• Konsequenzen mangelnder Verarbeitung
• Schluss...
• Anhang: Übersichten und Interventionen
|
|
| Erschienen: September 2012 |
| Verlag: Starks-Sture-Verlag |
ISBN-10: 3939586021
ISBN-13: 978-3939586029
|
|
|
|
|
| "Wenn lieben weh tut" |
| Ein Kommunikations-Ratgeber für Partner in der Borderline-Beziehung
|
| Der Verlag zum Buch: "Wenn lieben weh tut" richtet sich in erster Linie an Partnerinnen und Partner, die sich in einer Beziehung mit einem Menschen mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung befinden. Diese Verbindungen stellen für die Betroffenen immer eine große emotionale Belastung dar, da sie in einen Strudel von Idealisierung und Abwertung geraten sind und oft nicht mehr weiter wissen. Die Autorin Manuela Rösel, psychologische Beraterin aus Berlin, beschreibt in ihrem Buch Lösungsmöglichkeiten, angemessen mit dem Partner, der an der Borderline-Persönlichkeitsstörung leidet, umzugehen. Dabei legt sie besonderen Wert auf die Entwicklung der Selbstwahrnehmung von Betroffenen, denn diese wird in der Borderline-Beziehung zunehmend untergraben. Die Autorin gibt wertvolle Informationen über das typische Verhalten beider Seiten. Sie geht insbesondere auf einfühlsame Kommunikation, Grenzsetzung und den Umgang mit charakteristischen Verhaltensweisen, wie doppelte Botschaften, emotionale Erpressung oder Selbstverletzung ein. Zuletzt gibt sie wertvolle Hinweise zur Trennung, sollte diese unumgänglich werden. Mit dieser Lektüre bekommen Sie effektive Werkzeuge in die Hand, das Gefühl der Hilflosigkeit hinter sich zu lassen und neue Wege zu einem konstruktiven Umgang mit sich selbst und dem Partner zu gehen – damit lieben nicht mehr weh tut.
|
 Leseprobe |
Leseprobe |
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
 Leseprobe„Wenn lieben weh tut“
Leseprobe„Wenn lieben weh tut“
Ein Kommunikations-Ratgeber für Partner in der Borderline-Beziehung
Starks-Sture-Verlag – München/ISBN 3-9809496-7-2
© Copyright
2. Liebe als Grundbedürfnis, das verkannte Zentrum des Geschehens
Jede Menge Definitionen
Die Liebe… ein, wenn nicht sogar das zentrale Thema in der Borderline Problematik an sich und
ausgehend vom Sinn dieses Buches, für den Betroffenen, wie auch für den Partner und
Angehörigen, der Mittelpunkt des Geschehens. Insofern möchte ich dieser Thematik
angemessenen Platz und Raum widmen und Zitate bekannter Autoren und Psychologen wie
Erich Fromm, Peter Schellenbaum, Peter Lauster und Marshall Rosenberg an dieser Stelle
platzieren.
Eine Therapeutin konfrontierte mich einmal mit der Aussage, Borderliner können nicht lieben.
Anfangs hat mich diese Erkenntnis erschreckt, dann habe ich mich entschlossen, dieser
Aussage auf den Grund zu gehen. Zunächst stellen sich hier viele Fragen. Was ist Liebe und
wozu braucht der Mensch sie. Ich habe Antworten gesucht und gefunden. Viele entsprechen
dem, was dem Großteil der Menschen in Bezug auf diesen Begriff vertraut ist.
So bezeichnet ein Lexikon die Liebe als die stärkste Zuneigung, die ein Mensch für einen
anderen empfinden kann, ein Gefühl inniger und tiefer Verbundenheit mit dem Nächsten.
Peter Lauster schreibt in seinem Buch „Die Liebe“, dass diese ganz allgemein positive
Zuwendung ist, sich auf alles erstreckt, was die Sinne erfassen können. Sie zeigt sich in der
Fähigkeit Aufmerksamkeit und Zuwendung zu geben, wobei sich dies nicht nur auf einen
anderen Menschen bezieht, sondern auf alles, was lebendig ist, das eigene Selbst ebenso, wie
das, was es umgibt.
Erich Fromm sieht in der Liebe intensive positive Zuwendung zum eigenen Sein, zur Umwelt
und zum Leben. Nur durch sie lässt sich die Quelle der Angst, nämlich das Bewusstsein des
Abgetrenntseins, überwinden. Der Begriff „Abgetrenntsein“ bezieht sich hierbei auf das
Bewusstsein des Menschen, seiner Vergänglichkeit ausgeliefert zu sein. Die daraus
resultierende Hilflosigkeit und Einsamkeit verlieren nur dann ihre Macht, wenn wir lieben.
Gelingt dies nicht, entstehen Schuld und Scham, „beweist“ sich die angenommene
Wertlosigkeit und potenziert sich die Angst. Ein höllischer Kreislauf, der nur durch das
durchbrochen werden kann, was verzweifelt gebraucht und gesucht wird, aber in sich nicht
gefunden werden kann, da die Angst es nicht zulässt….Liebe. Laut Erich Fromm ist die
wichtigste Voraussetzung für die Liebe, dass beide Partner sich „aus der Mitte ihrer Existenz
heraus miteinander verbinden, wenn also jeder sich selbst aus dem Zentrum heraus erlebt“.
Der Mensch muss sich also seiner Identität bewusst sein, Mittelpunkt seines Handelns und
Erlebens sein, sich frei und unabhängig fühlen und er selbst sein können. Ohne diese Basis ist
eine gesunde Liebe nicht möglich, da der Mensch nur dann eine Bindung mit einem Partner
eingehen kann, wenn er selbst mit sich „im Reinen“ ist.
Sullivan, ein amerikanischer Psychiater meint: Wenn die Zufriedenheit oder die Sicherheit
eines anderen für mich ebenso bedeutsam wird wie meine eigene Zufriedenheit oder
Sicherheit, dann ist dies der Zustand der Liebe.
Theodor Reik, ein kritischer Schüler Freuds geht noch weiter und kommt zu einer für viele
Menschen grausamen Erkenntnis: "Ein Mensch, der sich nicht selbst akzeptiert und seine
Selbstachtung nicht wiedererlangt, wird nicht lieben können. Wer nicht Mut und
Selbstvertrauen hat, wird niemals die Zuneigung eines anderen gewinnen können." Es taucht
die Frage der Bewertung auf, weil das Problem, das alle Menschen haben, in der
Selbstbewertung besteht, obwohl sie sich dessen meist nicht bewusst sind. Warum sind diese
Menschen mit sich selbst unzufrieden? Sie kommen sich unbewusst betrogen und unzulänglich
vor, weil sie Vergleiche anstellen zwischen dem, was sie sind, und dem, was sie sein möchten;
zwischen dem, was sie leisten, und dem, was sie leisten möchten. Sie fühlen sich gehindert,
weil sie unbewusst fürchten, dass sie versagt haben. Sie sehen, dass sie unfähig sind, ihre
Erwartungen von sich selbst zu erfüllen. Wer den anderen nur kritisiert, beschimpft, fordert,
wie das in fortgeschrittenen Stadien von Partnerauseinandersetzungen so beliebt ist, zerstört
die Voraussetzungen der Liebe.
Er wird so unattraktiv, dass nur ein Verblödeter ihn lieben könnte und er macht dem anderen
deutlich, dass er ihn nicht liebt. Wer nur Kritik, Schimpfe und Forderungen bekommt, kann ja
gar nicht (für den anderen) liebenswert sein. Was mir wichtig ist, was mir wertvoll ist, das
schütze und behüte ich, das will ich nicht verlieren, das sollte ich erhalten wollen. Du liebst
einen Menschen, indem du ihm deutlich machst, wie wertvoll er für dich ist.
Peter Schellenbaum (Das Nein in der Liebe) sieht in der Liebe eine Erweiterung des Ich zu
einem Du. Sie ist der Sinn des Lebens, weil sich durch sie die Isolation überwinden lässt. Liebe
ist die Akzeptanz der Fremdheit des geliebten Menschen, ein Einswerden, ohne sich zu
verlieren und eine tiefe Einsicht in das Selbst. Sie ist die aktive, uneigennützige Hingabe an
das Du, Verschmelzung und Abgrenzung in einem und somit die Erweiterung des Ich.
Entgegen der verbreiteten Annahme, dass lieben ein Gefühl ist, sieht Marshall Rosenberg in
der Liebe ein Grundbedürfnis des Menschen. Ihr sind weitere Bedürfnisse wie Nähe, Vertrauen,
Zärtlichkeit, Intimität, Verbundenheit, Sicherheit u.v.m... untergeordnet. Individuell nach den
Werten und Bedürfnissen jedes Menschen, werden dabei Prioritäten gesetzt. Je nachdem, wie
diese Bedürfnisse erfüllt werden, zeigen sich entsprechende Gefühle. Glücklich, fasziniert,
hellwach, aufgekratzt, neugierig, lustvoll…, wenn das Bedürfnis nach Liebe sich erfüllt. Wird
dem Bedürfnis nach Liebe und seinen Unterbedürfnissen nicht entsprochen, fühlen wir uns
ängstlich, mutlos, unsicher, deprimiert, einsam ….
Hier findet sich auch eine Erklärung dafür, warum jeder Mensch den Begriff Liebe anders
definiert. Die prioritären Bedürfnisse, die jeder Mensch in Bezug auf sein Beziehungsverhalten
wahrnimmt, sind so individuell wie der Mensch selbst. Wo für den einen Wertschätzung und
Respekt an erster Stelle stehen, empfinden andere Nähe und Zuwendung als wesentlich.
Trotzdem sind in der Summe die Bedürfnisse aller Menschen in der Liebe gleich, sie gliedern
sich nur individuell unterschiedlich auf.
All diese Erkenntnisse vermitteln, trotz ihrer oft unterschiedlichen Aussagekraft, ein
faszinierendes Bild. Im Hinblick auf die Problematik Borderline, sehe ich eine alles
überschattende Sehnsucht nach Liebe. Ein unstillbares Bedürfnis nach Zuwendung,
Wahrnehmung, Nähe, Sicherheit und vielen der Liebe untergeordneten Bedürfnissen, ohne
jedoch, durch den Mangel an Identität, tatsächlich eine Chance zu haben, zu lieben und geliebt
zu werden, um der Isolation zu entrinnen. Sich an das Du hinzugeben und dabei das Ich zu
finden, Ängste zu überwinden und das Leben in sich zu integrieren, scheint undenkbar.
Die Liebe ist der Sinn des Lebens…, wenn ich mir Rosenbergs Auflistung (Kapitel Gefühle und
Bedürfnisse – Gewaltfreie Kommunikation) für unerfüllte Bedürfnisse ansehe, kann ich einen
Großteil dieser schmerzhaften Emotionen, diesem massiven Defizit der Borderline-Betroffenen
zuordnen. Ich halte es für sehr wichtig, sich dieses Zusammenhanges bewusst zu sein. Wut,
Zorn, Verbitterung, Gemeinheit… beziehen sich auf unerfüllte und nicht identifizierte
Bedürfnisse und niemals auf die Person, der als Ursache der überflutenden, schmerzvollen
Gefühle, die Verantwortung für die gefühlten Schmerzen übertragen wird.
Es ist in der Partnerschaft, dem Leben und der Gemeinschaft mit einem Borderline-Erkrankten
von höchster Wichtigkeit, sich darüber im Klaren zu sein, dass niemand die Ursache für das
Ausagieren emotionaler Überflutungen ist. Die Unfähigkeit, hinter den Gefühlen ein Bedürfnis
wahrzunehmen und das Unvermögen eine sinnvolle Strategie für die Erfüllung der Bedürfnisse
zu finden, ist die Ursache von Hilflosigkeit und Verlassenheitsgefühlen (Ich möchte dies immer
wieder betonen, denn es ist unsagbar schwer, sich dies vor Augen zu führen, wenn man sich
ausagierendem Verhalten ausgesetzt sieht). Hier potenziert sich das Drama in sich, der
Erkrankte verlässt sich selbst, in dem er im Strudel verinnerlichter Machtlosigkeit buchstäblich
ertrinkt. Trotzdem liegt der Umgang mit Emotionen, Bedürfnissen und Strategien in der
Verantwortlichkeit der betroffenen Person.
Wenn wir die Gesamtheit der Erkenntnisse der oben angeführten Psychologen überdenken,
werden wir zu der scheinbaren Konsequenz gelangen, dass Borderliner tatsächlich nicht in der
Lage sind zu lieben. Das sie zwar mit aller Intensität durch heftige schmerzhafte Emotionen
ihre Defizite signalisiert bekommen, sich aber durch das Ausagieren konträr einer sinnvollen
Strategie verhalten...
 Inhaltsverzeichnis„Wenn lieben weh tut“
Inhaltsverzeichnis„Wenn lieben weh tut“
Ein Kommunikations-Ratgeber für Partner in der Borderline-Beziehung
Starks-Sture-Verlag – München/ISBN 3-9809496-7-2
1. Begriffsklärungen und gedankliche Auseinandersetzungen mit
Persönlichkeitsmerkmalen
• Der Begriff Borderline ("Grenzlinie")…
• Was ist eigentlich eine Identitätsstörung?
• Partner und Angehörige…
• Einer trage des anderen Last….
• Gemeinsame Merkmale der Partner
• Irrtümer, die sich für viele Partner aus diesen Merkmalen ergeben
• Nach welchen Kriterien wählen wir unseren Partner?
• Angst
• Schwarz-Weiß
• Ambivalenz
• Berührungspunkte der Angst
• Notwendige Merkmale der Borderline-Partner
2. Liebe als Grundbedürfnis, das verkannte Zentrum des Geschehens
• Jede Menge Definitionen
• Kann man lieben lernen?
• Wo fängt Liebe an?
3. Co- Abhängigkeit
• Begriffsklärung
• Wege aus dem co-abhängigen Verhalten
4. Kommunikation, nicht alle Theorie ist grau
• Was passiert da eigentlich?
• Die Gewaltfreie Kommunikation nach M. B. Rosenberg
• Wie funktioniert die Gewaltfreie Kommunikation?
• Gefühle und Bedürfnisse
• SET Kommunikation
5. Von Manipulationen und Grenzen
• Emotionale Erpressung
• Woran kann ich Emotionale Erpressung erkennen?
• Die 4 Gesichter der Emotionalen Erpressung
• Wozu brauchen wir Grenzen?
• Wann müssen Grenzen gesetzt werden?
6. Was ich nicht wahrhaben will
• Verdrängungsmechanismen
• Primäre und sekundäre Gefühle
7. Doppelte Botschaften und wie wir sie vermeiden
• Vom Umgang mit Double Binds
• Möglichkeiten einer verbesserten Kommunikation zu dem Borderline-Betroffenen
8. Konkretes - Fragen und Antworten
• Wie genau kann ich reagieren, wenn ich emotional erpresst werde?
• Was ist, wenn mein Partner keine professionelle Hilfe in Anspruch nehmen will?
• Ehrlichkeit, Ehrlichkeit, Ehrlichkeit!!!!!!!!! (mangelnde Reflektion und inkongruentes Verhalten)
• Wie gehe ich mit Selbstmitleid um?
• Wie gehe ich mit Konfliktsituationen (Unstimmigkeiten) um?
• Einige Regeln für das aktive Zuhören
• Kommunikationsregeln für das Sprechen
• Weitere Möglichkeiten ausagierendem Verhalten sinnvoll zu begegnen
• Verzerrte Vergangenheit, ein ständiger Konfliktherd…
• Wie gehe ich mit Wutausbrüchen, verbalen Angriffen und übergriffigem Verhalten um?
• Wie reagiere ich auf Selbstverletzungen?
• Wie gehe ich mit Suizidandrohungen um?
• Was kann ich tun, wenn ich den Eindruck habe, dass mein Partner mit Selbstmord droht?
• Wie kann ich denn konsequent sein, wenn ich weiß, dass ich dafür verurteilt und
angegriffen werde?
• Wie kann ich Kontaktabbrüche vermeiden?
• Wie kann ich mich vor einer Beziehung zu einer Borderline-Persönlichkeit schützen?
9. Nach der Trennung
• Danach…und nun…?
• Warum fällt das Loslassen so unendlich schwer?
• Trauern (Krisenphasen)
• Möglichkeiten der bewussten Trauer und Verarbeitung
• Die Konsequenzen der Idealisierung
• Eigene Anteile entdecken
• Abschied Rituale, (Rituale und hilfreiche Verarbeitungsanregungen)
• Neubeginn
|
|
| Erschienen: 2012 |
| Verlag: Starks-Sture-Verlag |
ISBN-10: 3980949672
ISBN-13: 978-3980949675
|
|
|